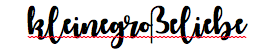Himmelhochjauchzend – zu Tode betrübt
Wochenbett und Kennenlernzeit - im Krankenhaus
Nach der Geburt verbrachten wir zwei Wochen auf der Kinderherzstation. Das kam nicht überraschend. Man hatte uns von vornherein gesagt, dass wir uns auf 2-3 Wochen Aufenthalt einstellen sollten, je nachdem, wie gut und wie schnell sich der Tiger an seinen neuen Lebensraum anpassen würde. Es musste sein, aber es tat weh. Wieviel lieber hätte ich die ersten Tage zu viert zuhause verbracht: intensives Kennenlernen, viel Kuscheln, den Tag ans Baby anpassen und einfach ein bisschen auf der Glückswolke treiben lassen.
Dieses Mal sah es bei uns anders aus. Auch wenn wir uns sehr gut aufgehoben gefühlt haben: eine Kinderherzstation ist leider keine Feel-Good-Station. Bei unserer Tochter hatten wir zwei Glückstaumel-Kennenlern-Tage im Krankenhaus und danach ging es nach Hause, wo wir uns als Familie finden konnten. Dieses Mal war mein Baby in der ersten Nacht nicht mal im selben Gebäude und danach wartete nicht das kuschelige Sofa, sondern ein mehrtägiger Untersuchungsmarathon auf uns. Auf der Kinderherzstation gab es nur wenig rosa Glückswolken-Gefühl. Wir lagen nicht zwischen glücklichen Müttern und den süßesten Neugeborenen, sondern zwischen Eltern mit großen Sorgen, und teils schwerkranken Kindern & Jugendlichen, die zum Teil schon Wochen oder Monate auf der Station verbracht hatten. Hier fingen Leben nicht nur an, hier wurde um Leben gekämpft, und hier endete es manchmal leider auch.
Wochenbett im Dreibettzimmer
Wir lagen in einem Dreibettzimmer – belegt mit drei Kindern und (meistens) drei Begleitpersonen. Drei Kinder, drei Monitore, dreifach Alarme. Neben einem anderen Baby und seiner Mama hatten wir einen etwa 10-jährigen Jungen auf dem Zimmer, der neben dem Herzfehler ganz viele andere Baustellen hatte und durch einen Schlaganfall drei Monate vorher alles verlernt hatte – das Gehen, das Sprechen, das Essen, das Trockensein…alles. Während von vor dem Frühstück bis spät nach dem Abendessen der Besuch ein- und ausging, blieb nachts nur selten jemand da. Wenn er nachts allein war, schrie er nach seiner Mutter oder seiner Schwester, rief und klingelte im Minutentakt nach dem Nachtdienst, riss sich die Zugänge heraus und schlug mit seinem Kopf bzw. seinem Helm gegen das Bett. Manchmal sah das Bett aus wie in einem Splatter-Movie. Nicht immer reichte eine Schwester, um ihn zu beruhigen. Manchmal musste nachts zweimal der Notdienst gerufen werden, um neue Zugänge zu legen, gegen die er sich mit Händen und Füßen wehrte. Und man selbst lag daneben und fühlte sich wahnsinnig machtlos.
Ruhe? Ankommen? Fehlanzeige
In dieses Zimmer kehrte niemals Ruhe ein. Wir hatten das Bett an der Tür, d.h. jeder Besuch, jede Schwester, jeder Therapeut, jeder gerufene Nacht- und Notdienst – jeder ging an unserem Bett vorbei. Wenn ich sage, dass ich in diesem Bett nie zwei Stunden am Stück geschlafen habe, ist das keine Übertreibung. Weder ich noch der Tiger kamen zur Ruhe. Jedes Mal, wenn jemand die Tür laut zufallen ließ (und die besuchreiche Familie knallte die Türen IMMER), wurde er wach, schrie, manchmal bis sein Alarm ausgelöst wurde. Oder man blieb in der Tür oder vor unseren Betten stehen, um über uns hinweg mit dem Jungen in seinem Bett zu unterhalten, und zwar in ähnlicher Tonart und Lautstärke, als müsse man gerade auf dem Fischmarkt die letzten Makrelen loswerden… Man setzte sich auch gern direkt vor mein Bett, wenn ich abpumpte. Dazu schienen sie eine Vorliebe für Einläufe zu haben – vorzugsweise kurz bevor die Familie ging und nachdem der Reinigungsdienst gerade durch war. Sie reagierten auf keine Ansprache. Es war furchtbar. Das gesamte Team wusste um die Probleme, konnte uns aber nicht helfen, da die Station komplett belegt war.
Wie gern wäre ich einfach mal geflüchtet. Aber das war nicht möglich. In den ersten Tagen konnten wir das Zimmer nur für Arzttermine verlassen. Spaziergänge waren anfangs nicht erlaubt. Den Tiger allein lassen, um mal durchzuatmen, war für mich bei der Zimmerbelegung keine Option. Nach fünf Tagen ging ich auf dem Zahnfleisch. Der Tiger wurde quengeliger und quengeliger. Die Milchproduktion stockte. Wir hatten die Schwestern bereits angesprochen, aber die Familie wirkte, was die Lautstärke anging, uneinsichtig. Und ich hatte einfach keine Kraft, mehr einzufordern. Zudem tat mir der Junge wahnsinnig leid und für die Unruhe, die er verursachte, konnte er einfach nichts.
Die Nerven liegen blank
Aber: Dem Tiger fehlte Ruhe. Mir fehlte Ruhe. Ich war so unglaublich müde. Mein Kopf brannte, mein Körper war soso schwer. Tagsüber mal eine Stunde am Stück schlafen? Fehlanzeige. Obwohl man eigentlich nichts zu tun hatte, waren die Tage trotzdem verplant. An manchen Tagen musste der Tiger vor und nach jedem Stillen gewogen werden. Stillen war also nicht mehr „Schreien, Shirt hoch, Stillen“, sondern „Schreien, alle Kabel abstöpseln, Alarme pausieren, Gemeinschaftswaage desinfizieren, Tücher drauf verteilen, Kind wiegen, aufschreiben (das Gehirn einer übermüdeten Mutter ist sehr unzuverlässig), alle Kabel wieder anstöpseln, stillen, Kabel wieder abstöpseln, wiegen, aufschreiben, alle Kabel anstöpseln, Monitor starten, Waage desinfizieren – und in den meisten Fällen direkt mal die Milchpumpe anwerfen. Manchmal hatte der Tiger 20min später schon wieder Hunger, weil er vor Erschöpfung nicht genug gegessen hatte. Jede nasse Windel wurde gewogen, jede Milchflasche abgelesen. Alles musste protokolliert werden. 5-6 x täglich hing ich an der Milchpumpe – zusätzlich zum Stillen. Milch kühlen, einfrieren, aufwärmen, Flaschen sterilisieren. Zwischendrin immer wieder Blutdruck, Temperatur, Sauerstoffsättigung messen. BGA abnehmen. Hier noch mal zum Röntgen. Dort noch mal ein EKG. Alarme wurden überprüft. Frühstück. Mittag. Abendessen. Irgendwann schnell duschen. Vielleicht mal kurz eine halbe Stunde spazieren, zwischen wiegen, stillen und der nächsten BGA. Und immer wieder abpumpen.
Die Tage waren unstrukturiert strukturiert. „Heute Vormittag kommt jemand zum Hörtest“ – heißt: Wir warten auf dem Zimmer, bis irgendwann irgendjemand im Laufe des Vor- oder Nachmittags zum Hörtest kommt. Spaziergang, Duschen o.ä. wartete ebenfalls.
Hab ich schon erwähnt, dass ich müde war?
Diese unglaubliche Übermüdung, die Wartezeit-Langeweile und die ständige Anspannung, weil Blutwerte nicht sind wie sie sein sollen oder man gespannt auf die Ergebnisse der Organscreenings wartet, gepaart mit all den immer wieder ausgelösten Alarmen und den Krankheitsverläufen, die man am Essenswagen, vor dem Behandlungszimmer oder dem Bad hörte, brachten mich tatsächlich an den Rande des Wahnsinns. Es war furchtbar. Abends lag ich weinend im Bett. Das hier konnte doch nicht wirklich unser „neues“ Leben sein?
Glücklicherweise hatte ich in der anderen Zimmernachbarin einen echten „partner in crime“. Wir haben gegenseitig ein Auge auf unsere Jungs gehalten, wenn einer mal schnell zur Toilette, Milch einfrieren, Flasche aufwärmen oder Mittagessen holen musste. Wir haben uns zugehört. Wir haben uns getröstet. Wir haben versucht, uns Mut zu machen.
Als ich eines Abends Jakob und die Krabbe auf dem Flur verabschiedete und allein zurück ins Zimmer ging, liefen mir die Tränen übers Gesicht. Eine der Schwestern muss es bemerkt haben, kam hinter mir mehr und fragte, ob alles in Ordnung sei. Da brachen alle Dämme. Ich entschuldigte mich und sagte, dass es vielleicht gerade einfach ein bisschen viel sei – die Wochenbetthormone, die schlaflosen Nächte, die ständigen Alarme in einem Zimmer mit drei Patienten, diese immense Unruhe und die wahnsinnig große Angst vor dem, was die Zukunft bringt, die schlimmer wurde, je mehr ich hier sah. Es fühlte sich an, als würde mich eine riesige Welle immer wieder unter Wasser ziehen.
Sie nahm mich Ernst. Sie vereinbarte ein Gespräch mit einer Psychologin und organisierte mir einen Tag später für zwei Nächte ein Einzelzimmer.
Einmal kurz durchatmen
Die Ruhe tat uns beiden wahnsinnig gut. Der kleine Tiger schlief nachts plötzlich vier (!) Stunden am Stück. Und ratet wer noch! Ich durfte das Bad im Zimmer nutzen und musste nicht ins Gemeinschaftsbad auf dem Flur (gibt es im neuen Kinder-UKE glücklicherweise auch gar nicht mehr!)– und konnte mein Kind so guten Gewissens kurz schlafend bei geöffneter Badezimmertür im Zimmer zurücklassen. Wir haben tagsüber geschlafen. Ich konnte mit Jakob in Ruhe über unsere Ängste und die Untersuchungen sprechen. Der kleine Muck war so ausgeglichen, so ruhig, so fröhlich. Die Milch schoss endlich wieder in gewohnter Menge ein. Und: wie gut ist bitte Abpumpen ohne Publikum? Es war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Auch das Gespräch mit der Psychologin war sehr hilfreich. Man sagt ja, dass Tränen die Seele reinigen. Ich habe meine Seele 60 Minuten gereinigt. Ich fing beim ersten Satz an und hörte erst auf, als ich wieder rauskam. Aber ich fühlte mich leichter. Die Ängste waren hinterher zwar nicht kleiner, aber sie wurden auch erstmal nicht größer. Es tat so gut, einfach bei jemandem, den ich nicht kannte, all meine Ängste und Sorgen auszuschütten und einen neutralen Rat zu bekommen.
Da ist es - das Licht am Ende des Tunnels!
Nach und nach wurde beim Tiger alles stabiler. Die Blutwerte wurden stabiler, die Untersuchungen wurden weniger. Die Herzfrequenz war gleichmäßiger. Hatte er in den ersten Tagen manchmal ordentliche Tachykardien mit einer Herzfrequenz von über 220, wurden diese immer seltener. Wir durften länger (mit Monitor) spazieren gehen. Mussten nicht mehr vor und nach jedem Stillen wiegen. Es pendelte sich ein. Es schien, als würde er sich sehr gut akklimatisieren und sein Körper und vor allem sein Herz sich sehr gut an die Außenwelt anpassen.
Nach genau zwei Wochen ging es endlich nach Hause. Für die letzten vier Nächte waren wir noch einmal im Dreibettzimmer. Man hatte statt des älteren Jungen ein weiteres Neugeborenes aufs Zimmer gelegt. Alle nahmen Rücksicht aufeinander und trotz zwei Neugeborener und einem weiteren Baby war es relativ ruhig. Für uns war es mehr als Zeit endlich nach Hause zu kommen. Auch wenn ich Angst hatte, ohne die Monitore zuhause eventuell etwas zu übersehen: Ich konnte es kaum erwarten, endlich unser Familienglück zu viert zuhause zu beginnen.